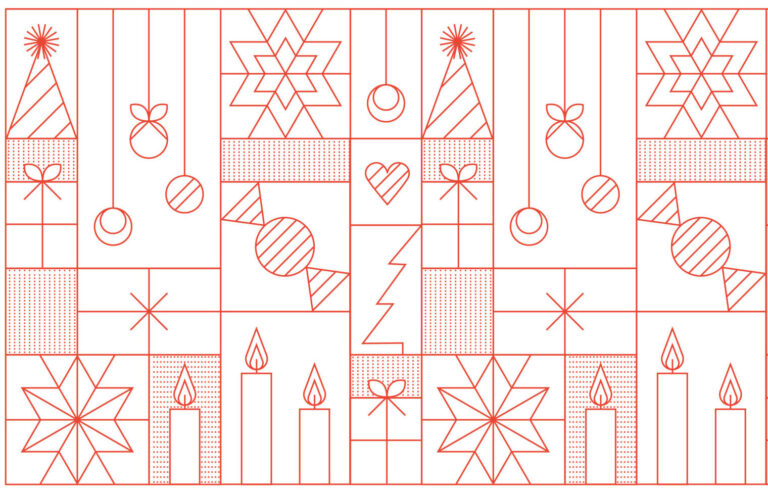Künstlerin Eva Schlegel kennt die Höhen und Tiefen des Künstler*innen-Daseins. Seit 20 Jahren unterstützt sie die neunerhaus Kunstauktion. Ein Gespräch über monumentale Skulpturen, das Schaffen von Über-Lebens-Räumen und Selbstbestimmung.
neunerhaus: Sie unterstützen die neunerhaus Kunstauktion schon seit über 20 Jahren. Wie kam es dazu, was sind Ihre Beweggründe?
Eva Schlegel: Ich bin als Künstlerin und als Person, die in einer großen Familie aufgewachsen ist, sozial veranlagt. Ich finde es ganz wichtig, dass man aufeinander schaut und es ist die Aufgabe einer reichen Gesellschaft, wie wir es sind, auch die Bedürftigeren mitzunehmen. Ich habe relativ früh Michael Walk (Anm. Kurator neunerhaus Kunstauktion, hier im Interview) kennengelernt, der einen guten Blick für Kunst hat und toll über neunerhaus gesprochen hat. Es sollte mehr Institutionen und Häuser geben, die Wohnraum zur Verfügung stellen und dadurch nicht nur einen Über-Lebens-Raum, sondern auch einen Lebens-Raum schaffen.
Hatten Sie schon einmal Berührungspunkte mit Obdach- oder Wohnungslosigkeit?
Ich selber nicht. Aber während des Studiums hatte ich sehr wenig Geld. Ich habe damals geraucht und war ziemlich abgebrannt. Das war so schlimm, dass ich mich gefragt habe: Kaufe ich mir jetzt eine Semmel oder Zigaretten? Eine Studienkollegin hat meine Not bemerkt und mich spontan zum Frühstück eingeladen. Das werde ich nie vergessen. Es hat mich sehr beeindruckt, dieses Einander-helfen. Sie lebt inzwischen in London, erst letztes Jahr haben wir wieder darüber gesprochen.
Wenn man während des Studiums kaum Geld hat und dann in die schillernde Kunstwelt eintritt, war das ein Schock für Sie?
Das mit der schillernden Kunstwelt ist etwas, was man auch nicht so ganz glauben kann. Es gibt dort natürlich sehr viele reiche Leute. Aber mein Platz ist ein anderer. Das Schöne am Künstler-Dasein ist die Selbstbestimmung über die eigene Zeit und Energie. Das war mir immer am wichtigsten. Ich mag es, meinen Tag selbst einzuteilen. Natürlich gibt es Aufs und Abs, es gibt Zeiten, da muss man sich wirklich überlegen, wie man jetzt über die Runden kommt. Egal, ob die Arbeiten nun im großen Ausmaß gezeigt werden oder nicht, ich will und muss ja von den Verkäufen leben. Manchmal geht es gut, da kann man sich dann Reisen leisten, und das Leben ist herrlich.
Hätten Sie sich damals im Studium gedacht, dass Sie von Ihrer Kunst leben können?
Ja, das war Bedingung. Mir war klar, wenn ich das machen will, muss ich auch davon leben können. Mein Vater war sehr streng und sehr genau mit dem Geld. Meine Eltern waren gegen den Beruf Künstler, Künstlerin. Der Kompromiss, den ich mir ausgehandelt habe war, dass ich zusätzlich das Künstlerische Lehramtstudium mache. Nach dem Diplom hat sich aber herausgestellt, dass ich meine Arbeit gut kommunizieren kann, ich habe zu meinen Eltern gesagt: Das Lehramt mache ich nicht.
Wie sehen Sie die Kunst in den nächsten 20 bis 25 Jahren?
Ich bin beunruhigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist essenziell, dass die Gesellschaft nicht durch Krieg oder Armut bedroht ist, da Kunst sonst nicht mehr als notwendig erachtet wird. Kunst gedeiht natürlich in einem wirtschaftlich florierenden Rahmen gut. Im Moment kämpfen wir mit Inflation, die wirtschaftliche Situation ist angespannt. Es schließen Galerien, die Museen bekommen immer weniger Geld. Der Staat reduziert seinen Auftrag, Kunst zu ermöglichen. Ich hoffe, dass die Kunst immer ein wichtiger Faktor bleiben wird, auch analoge Kunst in Zeiten der künstlichen Intelligenz, die natürlich sehr viel generieren und visualisieren kann. Aber Kunst ist mehr als die Mischung der schon bestehenden Formulierungen. Kunst ist auch immer ein gesellschaftlicher Kommentar, ist ein Konzept, das etwas beiträgt. Und die Schönheit und die Emotionalität der Kunst darf man auch nicht vergessen.
Mit welchen Themen oder Kontexten beschäftigen Sie sich gerade, oder schon sehr lange?
In meiner gesamten künstlerischen Zeit setze ich mich mit Raum und seinen unterschiedlichen Aspekten auseinander. Es ist der architektonische Raum, manchmal der Weltraum, der physikalische Raum, der soziale Raum. Es gibt ganz unterschiedliche Begriffe oder Zuordnungen zu Raum. Ich versuche, die Räume zu öffnen und die Wahrnehmung zu verändern. Ein architektonisch geplanter Raum kann ermöglichen oder verhindern. Wie am Beispiel der Städteplanung, wenn man Plätze oder Durchgänge so schafft, an denen niemand stehen bleiben will oder die gar gefährlich sind.
„Ein Raum kann ermöglichen oder verhindern.“
Raum ist vielfältig und kann viel – auch verhindern. Eva Schlegel im Gespräch mit neunerhaus
Die diesjährige neunerhaus Kampagne lautet #ÜberLebenReden. Was ist für Sie der Unterschied zwischen Leben und Überleben?
„Überleben“ ist bedrohlich, denn es bedeutet einen wahnsinnigen Druck von außen und einen Notstand. Wenn ich überleben muss, bin ich gezwungen, Notwendigkeiten zu erfüllen. Während „Leben“ schon weniger Druck von außen und mehr Gestaltungsmöglichkeit für das eigene Leben suggeriert.
Sie machen Kunst für den öffentlichen Raum und mit Ihren Bildern auch Kunst für Drinnen. Worin liegt der jeweilige Reiz?
Bei den Arbeiten im öffentlichen Raum macht es mir total Spaß, in anderen, in großen Dimensionen denken. Wie im Parlament zum Beispiel, wo sich meine Skulpturen befinden, die sehr komplex und kaum zu bauen sind. Ich liebe es, Probleme zu lösen, dazu braucht es aber immer ein Team aus Statikern, Architektinnen und guten Handwerkern.
Die Arbeit im Atelier, also die Fotos, die Malereien, die Zeichnungen – das ist eher intim. Da genieße ich es sehr, allein im Atelier zu arbeiten, ich kann mich selbst und die Zeit vergessen. Das ist eine Quelle für viele neue Ideen.